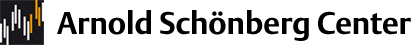1.Mondestrunken
2. Colombine
3. Der Dandy
4. Eine blasse Wäscherin
5. Valse de Chopin
6. Madonna
7. Der kranke Mond
8. Nacht (Passacaglia)
9. Gebet an Pierrot
10. Raub
11. Rote Messe
12. Galgenlied
13. Enthauptung
14. Die Kreuze
15. Heimweh
16. Gemeinheit
17. Parodie
18. Der Mondfleck
19. Serenade
20. Heimfahrt
21. O alter Duft
AUFFÜHRUNGSDAUER: ca. 34 Min.
TEXT: Otto Erich Hartleben nach Albert Giraud
VERLAG:
Universal Edition
Belmont Music Publishers (USA, Kanada, Mexico)
Die durch fanatische Anhänger und Gegner seiner Kunst gelegentlich der Aufführungen des »Pierrot lunaire« in Wien hervorgerufenen ruhestörenden Scenen veranlassen Herrn Arnold Schönberg an seine Mitwirkung die Bedingung zu knüpfen, dass ihm absolute Ruhe während der Dauer des Musizierens garantiert wird und das Publikum darauf verzichtet, während der Pausen die Aufnahmefähigkeit zu untergraben. (Kaufmännischer Verein Regensburg, 1914)
Arnold Schönberg (1874, Wien – 1951, Los Angeles) → Komponist, Schriftsteller, Maler, Lehrer, Theoretiker, Erfinder, Leitfigur der Wiener Schule, Vordenker der Zwölftonmethode, Elementarereignis der neueren Musikgeschichte
Pierrot (17. Jahrhundert, Bergamo) → Bühnenfigur der Commedia dell’arte; interkultureller Multimediastar in bildender Kunst, Literatur, Musik und Film; Popularitätshöhepunkt im 19. Jahrhundert; Exzentriker, Melancholiker mit Hang zum Mondlicht, Symbolgestalt für Exaltationen aller Arten
Pierrot lunaire op. 21 (1912, Berlin) → Melodramenzyklus in drei Teilen (zu je sieben Gedichten) für eine Sprechstimme, Klavier, Flöte (auch Piccolo), Klarinette (auch Bassklarinette), Geige (auch Bratsche) und Violoncello; Spiellänge mit zwei Satzpausen: ca. 45 Minuten; Gründungsdokument der musikalischen Moderne; auch bekannt als »Solarplexus der Musik des frühen 20. Jahrhunderts« (Igor Strawinsky)
Arnold Schönbergs »Pierrot lunaire« op. 21, ein Schlüsselwerk der musikalischen Moderne, entstand 1912 in Berlin im Auftrag der Vortragskünstlerin Albertine Zehme. Die Sängerin, Rezitatorin, Stimmbildnerin (sowie ehemalige Schülerin Cosima Wagners) verfolgte in ihren Rezitationen eine höchst eigenwillige Ästhetik, darin sie »dem Ohr seine Stellung fürs Leben zurückerobern« wollte: »Ich fordre nicht Gedanken-, sondern Tonfreiheit! […] Um unsere Dichter, um unsere Komponisten mitzuteilen, brauchen wir beides, den Gesangs- wie auch den Sprachton. Die unablässige Arbeit nach dem Suchen der letzten Ausdrucks-Möglichkeiten für die ,künstlerischen Erlebnisse im Ton hat mich diese Notwendigkeit gelehrt.« (Programmheft eines Rezitationsabends mit den Pierrot lunaire-Gedichten von 1911). Diese Suche nach uneingeschränkter »Tonfreiheit« führte sie folgerichtig zu einem kongenialen Freiheitskämpfer der Klänge: »Ich habe weder einen Grundton, noch sonst einen Ton herausarbeiten müssen; ich durfte jeden der 12 Töne benutzen, mußte mich nicht in das Prokrustes-Bett einer motivischen Phrasierung zwingen, brauchte keine Abschlüsse, Abschnitte und Phrasenanfänge und -enden zu berücksichtigen.« (Schönbergs Randbemerkung in einem Exemplar von Ferruccio Busonis »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst«, 1916)
Die freie Übertragung der 1884 erschienenen französischen Gedichtsammlung »Pierrot lunaire. Rondels bergamasques« von Albert Giraud durch den deutschen Dichter Otto Erich Hartleben beansprucht den Rang eines eigenständigen poetischen Werkes. Hartlebens Übersetzung erschien nach der Erstausgabe 1892 in mehreren Folgeauflagen und lag vor Schönbergs Beschäftigung mit dem Stoff um die alte commedia dell’arte-Figur bereits in einer Reihe von anderen Vertonungen vor. Die narrativ geordnete Textarchitektur und deren Vertonung in einem »spezifisch musikalisch realisierten Formgedanken« sind auf eine »allegorische Parabel über Künstler und Künstlertum« fokussiert. Schönbergs Faszination von den Gedichten, die er in ein »farbiges Zwischenreich von Singen und Sprechen« (Reinhold Brinkmann) mit einem kleinen Ensemble überführte, übte einen enormen Schaffensimpuls auf ihn aus. Die dramaturgische Disposition beruht auf der später Titel gebenden Zahlenordnung 3x7 (»Dreimal sieben Gedichte…«), die in der Opuszahl des Werkes eine numerologisch deutbare Entsprechung findet. Von historischem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch Schönbergs Inspiration durch den insgesamt 21 Klavierminiaturen umfassenden Zyklus »Carnaval« op. 9 von Robert Schumann mit den Charakterstücken »Pierrot«, »Arlequin«, »Chopin«, »Pantalon et Colombine«.
Im I. Teil aus Schönbergs Opus 21 dominiert die Thematik des Künstlers, dessen Gedankenwelt und Schaffensimpulse durch den Mond symbolisiert werden. Der II. Teil senkt sich nach einer »todeskranken« Eintrübung des Mondlichts tief und tiefer in das Schattenreich des Todes, »der Sonne Glanz« wurde durch schwarze Riesenfalter als Sendboten der Nacht gelöscht. Die »Rote Messe« (Nr. 11) kann innerhalb des Liederkreises als Peripetie verstanden werden. Pierrots »Heimfahrt« nach Bergamo beschließt den an parodistischen Elementen reichen III. Teil. »Trotzdem sie alle grotesk sind, so kann man die drei Theile (nach einigen überwiegenden Nuancen) immerhin mit lyrisch, tragisch und humoristisch überschreiben.« (Ferruccio Busoni an Egon Petri, 19. Juni 1913)
»Pierrot lunaire« ist zur Zeit seiner Entstehung ein gattungshistorischer Solitär, der einige Besonderheiten des Zusammenklangs vereint. Eine Sprechstimme und fünf Spieler werden in alternierenden Besetzungen, d. h. in unterschiedlichen Kombinationsvarianten, eingesetzt: Flöte spielt auch Piccolo, Klarinette auch Bassklarinette, Geige auch Bratsche. In Soli, Duos, Trios, Quartetten und Quintetten lässt der Komponist aus diesen Konstellationen einen Kosmos an klanglichen Schattierungen zur Sprechstimme entstehen. Die spezifische Instrumentierung der Texte und ihrer poetischen Sphären folgt traditionellen Vorbildern. So ist etwa die Flöte dem Mond zugeordnet, indes die Piccoloflöte Pierrots Clownerien untermalt und mit ihrem hellen Kolorit Licht und Glanz nachzeichnet. Das sonore Cello agiert in einer Hemisphäre zwischen Ernsthaftigkeit und Sentimentalität, die Geige bzw. Bratsche ist dem romantisierenden Idiom verschrieben. Zur Interpretation des Vokalparts sind einige Aussagen des Komponisten überliefert, die ebenso wie eine historische Schallplatteneinspielung unter seiner Leitung zwischen Partitur und Interpretin vermitteln: »Eines muss ich sofort und mit aller Entschiedenheit sagen: ›Pierrot lunaire‹ ist nicht zu singen! Gesangsmelodien müssen in einer ganz anderen Weise ausgewogen und gestaltet werden als Sprechmelodien. Sie würden das Werk vollkommen entstellen, wenn Sie es singen ließen, und jeder hätte recht, der sagte: so schreibt man nicht für Gesang!« (Schönberg an seinen Schüler Alexander Jemnitz, 15. April 1931)
Die in Besetzung, Klangfarbe, Tonsatz, Form/Genres, Symbolik/Semantik stets changierende Gestaltungsweise der Melodramen deutet darauf hin, dass Schönberg mit 21 höchst stilisierten Kabinettstücken in eine Meisterschaft mit sich selbst getreten ist. Jedes einzelne Melodram weist ein eigenes Prinzip auf, darin er »einem neuen Ausdruck entgegen« ging (Berliner Tagebuch, 13. März 1912). Die Loslösung von der traditionellen Kadenzharmonik erlaubte ihm, »jeden der 12 Töne« frei von überlieferten Ordnungskritieren einzusetzen: »Hier ist kein Verfahren, als der Einfall.« (Randbemerkung in Ferruccio Busonis »Ästhetik der Tonkunst«)
Der Komplexionsgrad der Partitur war zur Zeit der Werkentstehung so außergewöhnlich wie die musikalische Sprache des Zyklus. Die Interpreten der Uraufführung absolvierten nach unzähligen Stunden des Einzelstudiums insgesamt 25 Ensembleproben, ehe Schönberg das Werk eine Woche vor der offiziellen Premiere (am 16. Oktober 1912) im Choralion-Saal in Berlin geladenen Gästen erstmals zu Gehör brachte. Von der Uraufführung berichtet der Pianist und Schönberg-Schüler Eduard Steuermann in einem Interview: »Frau Zehme bestand darauf in einem Pierrot-Kostüm aufzutreten und alleine auf der Bühne zu stehen. Die Musiker und ihr Dirigent Schönberg befanden sich hinter einem ziemlich komplizierten Paravant – kompliziert deshalb, weil es auf dieser kleinen Bühne nicht ganz einfach war etwas zu konstruieren, das zwar den Blickkontakt zwischen Sprecherin und Ensemble ermöglichte, letzteres jedoch vor den Blicken des Publikums verbarg. […] Und der Erfolg? Natürlich gab es einen ›Skandal‹ […], aber auch heftige Ovationen.«
Wenn Schönberg als musikalischer Schrittmacher nachfolgender Komponistengenerationen mit seiner neu formulierten Klangrede auch selbst eine neue Tradition begründen sollte, so komponierte er selbst stets im Rückblick auf die eigene (deutsche) Tradition, in deren Entwicklungslinie stehend er sich begriff. Schönbergs Rückgriff auf alte Formen und Satzmodelle in Opus 21 (darunter Passacaglia, Fuge, Kanon, Polka, Walzer, Barcarole) reflektiert eine »historische Repräsentation der Künstler-Problematik in der Moderne« (Reinhold Brinkmann). Schönberg stattete das Inventar seiner Textausdeutung auch auf motivischer, rhetorischer und satztechnischer Ebene mit zahlreichen Anspielungen auf Musikhistorisches aus, nachhörbar an (versteckten) Zitaten aus Werken älterer und jüngerer Meister. Darunter finden sich Bachs »Wohltemperiertes Klavier« (in »Madonna«, Nr. 6) ebenso wie Wagners »Parsifal« (im »Gebet an Pierrot«, Nr. 9) oder »Heldenleben« von Richard Strauss (in »Der Dandy«, Nr. 3). Eine Wienerische – und für Schönberg heimatliche – Note liegt in der Anspielung auf das »Künstlerleben« von Johann Strauß in »Der Dandy«, wie in der Forschung nachgewiesen wurde. Dem »Triebleben« seiner Klänge (Schönberg, »Harmonielehre«) hauchte der Komponist in Rückbesinnung auf seine künstlerische Heimat, der deutschen Musikgeschichte nach Johann Sebastian Bach, einen »alten Duft aus Märchenzeit« ein.
Die Interpretation der irrealen »Pierrot«-Figur entzieht sich einer gängigen Verstehensroutine und bleibt weitgehend Aufgabe unserer Phantasie. Im Programmheft der Uraufführung stellte Schönberg den Gedichten ein textlich (leicht modifiziertes) »Fragment über absolute Poesie« des deutschen Dichters Novalis voran: »Es lassen sich Erzählungen ohne Zusammenhang, jedoch mit Assoziation, wie Traum, denken – Gedichte, die bloß wohlklingend und voll schöner Worte sind, aber auch ohne allen Sinn und Zusammenhang, höchstens einige Strophen verständlich, wie Bruchstücke aus den verschiedenartigsten Dingen. Diese wahre Poesie kann höchstens einen allegorischen Sinn im Großen und eine indirekte Wirkung haben.«
Therese Muxeneder | © Arnold Schönberg Center