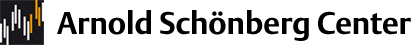Nr. 1: Sehr langsam (1920)
Nr. 2: Sehr rasch (1920)
Nr. 3: Langsam (1923)
Nr. 4: Schwungvoll (1920/1923)
Nr. 5: Walzer (1923)
AUFFÜHRUNGSDAUER: ca. 12 Min.
VERLAG: Wilhelm Hansen (Music Sales Classical)
Mit dem Finalsatz seines Streichquartett Nr. 2 op. 10 überschritt Arnold Schönberg 1908 die Grenzen des Dur/Moll-tonalen Systems. Die von einer Singstimme vorgetragenen Textworte Stefan Georges »Ich fühle Luft von anderem Planeten« sollten sinnbildlich für seine nahe Zukunft stehen. Werk um Werk erschloss Schönberg ungekannte Klang- und Ausdruckswelten und erfand immer wieder neue Strategien, seine schöpferische Vorstellung in eine tragfähige musikalische Architektonik zu überführen. Das Erfolgsstück »Pierrot lunaire« op. 21 markierte 1912 das Ende dieser fruchtbaren Schaffensphase.
Während der Kriegszeit vermochte er lediglich seine Vier Orchesterlieder op. 22 abzuschließen. Darüber hinaus arbeitete er an einem mehrteiligen Oratorium, zu dessen Gestaltung er nach Einheit stiftenden Strukturelementen strebte. Im Rückblick betrachtete Schönberg jene Phase als eine Zeit des Suchens, die gewonnene Freiheit mit einer sicheren kompositionstechnischen Basis zu verbinden: »Früher hatte die Harmonie nicht nur als Quelle der Schönheit gedient, sondern […] als Mittel zur Unterscheidung der Formmerkmale. […] Die Erfüllung all dieser Funktionen – vergleichbar der Zeichensetzung im Satz, der Unterteilung in Abschnitte und der Zusammenfassung in Kapiteln – war kaum mit Akkorden zu gewährleisten, deren konstruktive Werte bisher noch nicht erforscht worden waren. […] Eine neue farbige Harmonie wurde geboren; aber vieles ging verloren.«
Für die Öffentlichkeit entstand der Eindruck, Schönberg sei kompositorisch verstummt, zumal seit der epochalen Premiere der »Gurre-Lieder« 1913 kein neues Werk mehr von ihm aufgeführt worden war. Dies versprach sich zu ändern, als er am 30. Juni 1920 eine Anfrage von Henry Prunières erhielt, Herausgeber der französischen Musikzeitschrift »La Revue musicale«. Deren erste Nummer sollte als Notenbeilage ein »Tombeau de Claude Debussy« enthalten, für das einige der »besten Musiker Europas« um Beiträge gebeten wurden – »ein künstlerisches Ereignis, das eine große moralische Bedeutung für die Einigkeit unter Künstlern der ganzen Welt haben wird.« Der Titel »Tombeau« nimmt eine besonders im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts verbreitete Gattung auf: Es handelte sich dabei meist um anspruchsvolle Kompositionen, dem Gedenken einer berühmten Persönlichkeit als musikalischer Grabstein gewidmet. Neben Schönberg sollten illustre Kollegen wie Béla Bartók, Maurice Ravel und Igor Strawinsky dem französischen Meister die letzte Ehre erweisen. Mit 9. Juli 1920, neun Tage nach Erhalt des Briefes, datiert ein Klavierstück, das in getragenem Ton eröffnet. In der Oberstimme entfaltet sich eine verhaltene Melodie, deren Intervallbestand von den beiden Begleitstimmen übernommen und frei weitergesponnen wird. Ein polyphoner Satz entfaltet sich, dessen drei Stimmen jeweils 21, 20 und 13 Töne enthalten. Später werden diese Töne in exakt derselben Reihenfolge wieder aufgenommen, Rhythmus und Oktavlage jedoch derart verändert, dass ein völlig neuer musikalischer Charakter entsteht. Auch an anderen Stellen treten Segmente dieser Tonfolgen hervor, hörend nur schwer identifizierbar, dabei essentiell für die organische Anlage der Komposition. Am 27. Juli 1920 vollendete er ein weiteres Stück, das mit einer auffahrenden Geste einen deutlichen Kontrast zu seinem Vorgänger setzt. Einen Tag später datiert der Beginn eines dritten Stückes, das durch regelmäßig wiederkehrende Tonkonstellationen strukturiert ist, welche in Figuren- und Akkordgruppen immer wieder neu angeordnet werden. Der Ansatz erschien vielversprechend – dennoch sollte es gut zweieinhalb Jahre dauern, bis Schönberg die Komposition abschloss. Die Anfrage der »Revue musicale« war inzwischen obsolet geworden, da Schönberg sich dagegen entschieden hatte, sein Stück einzureichen.
Anlass zur Wiederaufnahme des Projekts war ein Auftrag des dänischen Musikverlags Wilhelm Hansen, der zu einem beträchtlichen Honorar ein mehrsätziges Ensemblewerk sowie einen Zyklus von drei bis sechs Klavierstücken umfasste. Das bevorstehende Arbeitspensum war enorm, zumal Schönberg auch Obliegenheiten seines Hausverlags, der Universal-Edition, zu erfüllen hatte. Die vergangenen Monate standen im Zeichen der Suche und des Experiments: Mit den Klavierstücken von 1920 hatte Schönberg Möglichkeiten gefunden, Tonfolgen von ihrer Verknüpfung mit musikalischen Gestalten zu lösen und als strukturelles Rückgrat einer Komposition zu etablieren. Im Juli 1921 war aus diesem Ansatz ein Klavierstück entstanden, das die Arbeit mit Tonkonstellationen in einer Reihe aus den zwölf Tönen der chromatischen Skala verdichtete, die alleinige Grundlage aller musikalischen Gestalten war – später fungierte es als »Präludium« zur Suite für Klavier op. 25, die 1925 bei der der Universal-Edition erschien. Zugleich arbeitete Schönberg an einem Instrumentalwerk, das schließlich zur Serenade op. 24 ausgearbeitet werden sollte, bisher jedoch nur in fertigen und angefangenen Einzelsätzen vorlag.
Seine zahlreichen Pflichten veranlassten Schönberg zum Handeln. Für Wilhelm Hansen konzipierte er einen Zyklus, der schließlich den neutralen Titel Fünf Klavierstücke op. 23 tragen sollte. Das ehemalige »Tombeau pour Claude Debussy« sollte das Eröffnungsstück bilden, das andere bereits 1920 beendete Stück folgte als Nummer zwei. Zwischen 6. und 8. Februar 1923 komponierte Schönberg das dritte Stück, dessen Form Erwin Stein in seinem Artikel »Neue Formprinzipien« mit einer Fuge verglich. Im Unterschied zur auf Tonreihen basierenden Organisation von op. 23/1 erfand Schönberg hier ein fünftöniges Motiv, das »häufig in thematischer Bedeutung« vorkommt – also aufgrund einer gleichmäßigen rhythmischen Faktur hörend gut zu erkennen ist: »sonst aber durchkreuzen und verschränken sich die verschiedenen Formen der Grundgestalt derart, daß scheinbar ganz freie Melodien und Harmonien entstehen.« (Erwin Stein, »Neue Formprinzipien«) Für Nummer vier nahm Schönberg den Faden des unvollendeten Satzes vom Juli 1920 wieder auf und kennzeichnete regelmäßig wiederkehrende Tonkonstellationen mit den Buchstaben A bis D, die er gelegentlich durch arabische Ziffern weiter differenzierte. Auf Basis dieser Analyse seiner eigenen Komposition konnte er den weit zurückliegenden Entwurf bis zum 13. Februar schlüssig zu Ende führen. Gleich im Anschluss machte er sich an das Schlussstück, das ebenso pianistisch anspruchsvoll wie kompositionstechnisch ungewöhnlich ist. Eine Reihe aus zwölf Tönen wird fast durchgehend in derselben Abfolge verwendet, Rhythmus und Oktavlage sind frei behandelt. Dabei tritt die Reihe nie in Form eines Themas hervor, sondern ist lediglich abschnittsweise in melodischen Gesten zu hören, während die verbleibenden Töne begleiten. Trotz der experimentellen Anmutung schrieb Schönberg keine trockene Studie, sondern entfaltete die Reihe im 3/8-Takt eines Walzers, dessen Charakter in Begleitfiguren und melodischen Floskeln zutage tritt. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass dieser furiose Walzer bis heute immer wieder als Schönbergs erstes Zwölftonstück betrachtet wird. Der Komponist war an der Verwirrung nicht ganz unbeteiligt: die Fünf Klavierstücke erhielten die Opusnummer 23, die Serenade wurde zum Opus 24. Die eigentlich dazwischen vollendete Suite für Klavier mit dem Präludium vom Juli 1921 als Eröffnungsstück sollte die Serie als mustergültige Zwölftonkomposition mit der Opusnummer 25 abschließen. Die Fünf Klavierstücke op. 23 sind aus dieser Perspektive tatsächlich ein Vorläufer. Sie zeigen den Komponisten bei der Ergründung unterschiedlicher Möglichkeiten, aus abstrakten Tonfolgen musikalische Architekturen zu errichten – die Zwölftonreihe ist dabei lediglich ein Sonderfall. Über die musikhistorische Bedeutung hinaus lädt der Zyklus auf eine Reise durch Ausdrucks- und Klangwelten. Das musikalische Spektrum reicht vom zurückhaltenden Beginn über die kontrolliert-expressive Konstruktion des Mittelstücks bis zum außergewöhnlichen Finale, das ein scheinbar rigides Strukturprinzip in figuraler Vielfalt aufgehen lässt.
Eike Feß | © Arnold Schönberg Center