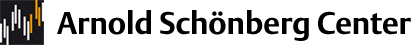Arnold Schönberg hat seit vielen Tagen in Prag geweilt und mit emsiger Sorgfalt die Aufführung seiner symphonischen Dichtung »Pelleas und Melisande« vorbereitet. Aber nicht diese stille, fachmännische Arbeit, sondern der lärmende, umstrittene, einem Aufruhr nicht mehr ganz unähnliche Erfolg des bedeutsamen Werkes hat aller Augen auf ihn gewendet.
Das ist der Lauf der Welt, aus der sich Schönberg übrigens nicht viel macht. Denn eben, da er auch hier anfing interessant zu werden, hat er schleunigst der Stadt den Rücken gewendet. Gestern um 12 Uhr mittags ist er mit Expreßzugsgeschwindigkeit wieder zu den Berliner Penaten heimgedampft. Deswegen hat er aber vorher doch einer Unterredung wacker standgehalten und sogar mit seinem Urteil über die Prager hat er nicht hinter dem Berg gehalten. Dieses Urteil war – ich hätte es ganz anders erwartet – für die Prager sehr schmeichelhaft. »Nirgends noch ist so ausdauernd und heftig um mich gekämpft worden wie in Prag«, sagte der von Wien wahrlich nicht Verwöhnte. »Aber man hat mein Werk doch mit Ernst angehört und erst am Ende durch die Ausdauer bewiesen, daß man es auch ernst genommen, für oder wider. Das ist für beide Parteien ehrend.« [...]
»In Wien hat man mich einmal nicht zu Ende hören wollen, aber das war ohne Zweifel vorbereitet, und das gleiche Werk, mein Fis-Moll Quartett, wurde in München ohne die geringste Demonstration aufgeführt. Ich hoffe auch nach den gestrigen Erfahrungen, für Prag eine solche würdige, sachliche Aufnahme, wenn das Werk nächstens hier gespielt werden sollte.« In der Tat steht eine solche Aufführung demnächst bevor. Am 18. März wird das Rosequartett sich im Kammermusikverein für das schon dadurch merkwürdige Werk einsetzen, daß es einen Gesangspart enthält, den hier Frau Gutheil-Schoder interpretieren wird.
»Worin mag denn überhaupt der Grund dieser Opposition liegen, da doch nicht anzunehmen ist, daß nur persönliche oder kunstunverständige Gegner sie zusammensetzen«, fragte ich. »Das scheint mir ganz klar: die Leute mögen deutliche Menschen nicht leiden. Deutliche Menschen nenne ich die stark betonten Persönlichkeiten, die ehrlich und entschieden ohne Konzessionen das aussprechen, was sie erfüllt. Vielleicht ist auch Lehar ein solcher deutlicher Mensch, aber dann ist er von der angenehmen und ich bin von der unangenehmen Sorte«, versetzte ironisch der Komponist.
»Aber bei der Ungewohntheit Ihrer Harmonien können Sie es doch den Leuten wirklich nicht übel nehmen, wenn sie nicht gleich mitgehen«, versuchte ich eine Verteidigung der Zischer, »Sie geben doch zu, daß Einiges mit Absicht häßlich klingt, weil es Häßliches malen soll ...«
»Nein, nein, häßlich durchaus nicht, nur schauerlich, unheimlich. Was ist denn schön oder häßlich in der Musik? Mir klingen auch Dissonanzen nicht häßlich. Überhaupt gibt es für mich zwischen Dissonanz und Konsonanz nur einen graduellen Unterschied, es handelt sich immer nur um Übergänge. Die Dissonanz ist ja das eigentliche belebende Element der Musik wie der Konflikt im Drama. Die Dissonanz ist der bewegende Motor, durch welchen allein die Bewegung fortschreitet. Schon der alte Bach hat die ärgsten Dissonanzen geschrieben, ärgere wie Bach schreibe ich auch nicht. Aber dort sind es die Ohren gewöhnt, bei mir ärgern sie sich noch.«
»Für den Kritiker mag aber oft Ihre neue Ausdrucksform eine Schwierigkeit bedeuten. Selbst wenn ihm der Wert Ihrer Musik evident ist, wie soll er in Worten seinem Publikum dafür den Beweis führen? Denken Sie sich einmal selbst in den Kritikerstuhl, was würden Sie wohl zu Laien über sich selbst kritisch zu sagen haben?«
Schönberg antwortete nicht gleich. »Objektiv zu sein und über sich selbst Klarheit zu gewinnen, gelingt manchen Menschen ihr ganzes Leben nicht, wie könnte ich das in wenigen Minuten. Aber immerhin: hätte ich zu schreiben, so würde ich erst fragen: ist ein ehrlicher Ausdruck hinter dem Wollen dieses Menschen zu spüren, steht hinter dem Werk überhaupt ein Mensch, und wie weit hat er sich ausgedrückt, und schließlich, in welche Kategorie soll ich dieses Wollen einreihen, hat er sich mit dem Niedrigeren oder hat er das Höchste gewollt? Und diese Fragen, über mich selbst gestellt, kann ich sie anders als in einem Sinne beantworten? Jede andere als die günstige Antwort wäre für mich ja ein berechtigtes Selbstmordmotiv.«
Und es lag keinerlei scherzhafte Lächelfalte bei diesem mannhaft-stolzen Bekenntnis auf Schönbergs klugem Antlitz, man spürte, daß ein Mensch auch hinter den Worten stand.
»Immerhin erleichtert die Kenntnis der Dichtung, die Ihnen bei dem Werke von gestern vorschwebte, das Verstehen so greller Klangzusammenstellungen. Sie haben aber auch absolute Musik geschaffen, würden Sie wohl sagen können, ob auch diesen Werken, dem Sextett oder den beiden Streichquartetten z. B. ein zusammenhaltender Gedanke zugrunde liegt, an den sich die Hörer zunächst klammern können?« – »Keineswegs. Selbst die Pelleas-Musik will ich absolut aufgefaßt wissen. Und seither habe ich keinerlei Programmusik geschrieben. Würde ich denn, wenn ich mit Worten sagen könnte, was ich fühle, die Töne wählen? Natürlich verbindet sich mir mit dem Geschaffenen eine Assoziation von konkreten Vorstellungen, aber die mag bei jedermann anders sein, und wer weiß, ob sie nicht gerade komplementär ist wie bei den Farben, wo die rote Farbe im Auge das Grün hervorruft. Wer mich versteht, der versteht mich ohne Worte. Erinnern Sie sich, was Schopenhauer von der Musik sagt? Die Musik ist eine Oper; zu der die Welt der Text ist, ungefähr; glaube ich. Das ist mir das Herrlichste an der Musik, daß sie dem Schöpfer bei aller Aussprache erlaubt, verschlossen zu bleiben, sein innerstes Geheimnis nicht zu offenbaren als eben durch die Musik, die nur der Gleichgestimmte versteht.«
»Dennoch stehen Sie nicht für sich da, ein erratischer Block in der Musikgeschichte, auch Sie müssen Ihre Meister gehabt haben. Wo sollen wir diese suchen? Gibt es über andere, frühere einen Weg zu ihnen?«
Schönberg bejahte und verneinte zugleich. »Natürlich habe ich gelernt. Wir alle haben von Wagner, von Brahms und Liszt und Bruckner, von Hugo Wolf gelernt. Als Strauss mir bekannt wurde, war ich schon ziemlich abgeschlossen. Die neueren, Pfitzner, Mahler haben mich bereits innerlich abgeschlossen gefunden, ihnen verdanke ich nichts. Dagegen habe ich – Sie werden vielleicht ungläubig lächeln – sehr viel von Mozart gelernt, besonders in Bezug auf die innere Bildung und den Bau der Melodie.« »Und wie steht es mit Debussy?«, fragte ich. »Ihr Pelleas entstand ja ungefähr gleichzeitig mit dem französischen Musikdrama; wie urteilen Sie über Debussys Auffassung des dichterischen Inhalts, die von der ihrigen wohl ziemlich abweicht?« – »Debussy gefällt mir sehr gut«, erklärte Schönberg bescheiden, »er war reifer als ich, als wir beide an das Werk herantraten, und er hat wohl auch Maeterlincks Stil richtiger getroffen.«
Noch ein freundlicher Tausch der Blicke. Draußen pfiff schon etwas wie ein Zug, und ich ließ rasch die Tür hinter mir ins Schloß fallen. Was ist die Musik doch eine geheimnisvolle Kunst! War hier ein Mensch, ernst, einfach, liebenswürdig und bescheiden, klug und scharfzüngig wohl, aber nicht böswillig sicher und voll reinen Willens. Aber was in ihm singt und dichtet, darüber haben also die Menschen sich in Gegnerschaft verfeindet, sich bitter erhitzt und können gar nicht zu einer Einigung kommen. Wird man es einst verstehen? »Nur Zeit!«, singt Dehmel.
Bohemia. Morgen-Ausgabe (2. März 1912)